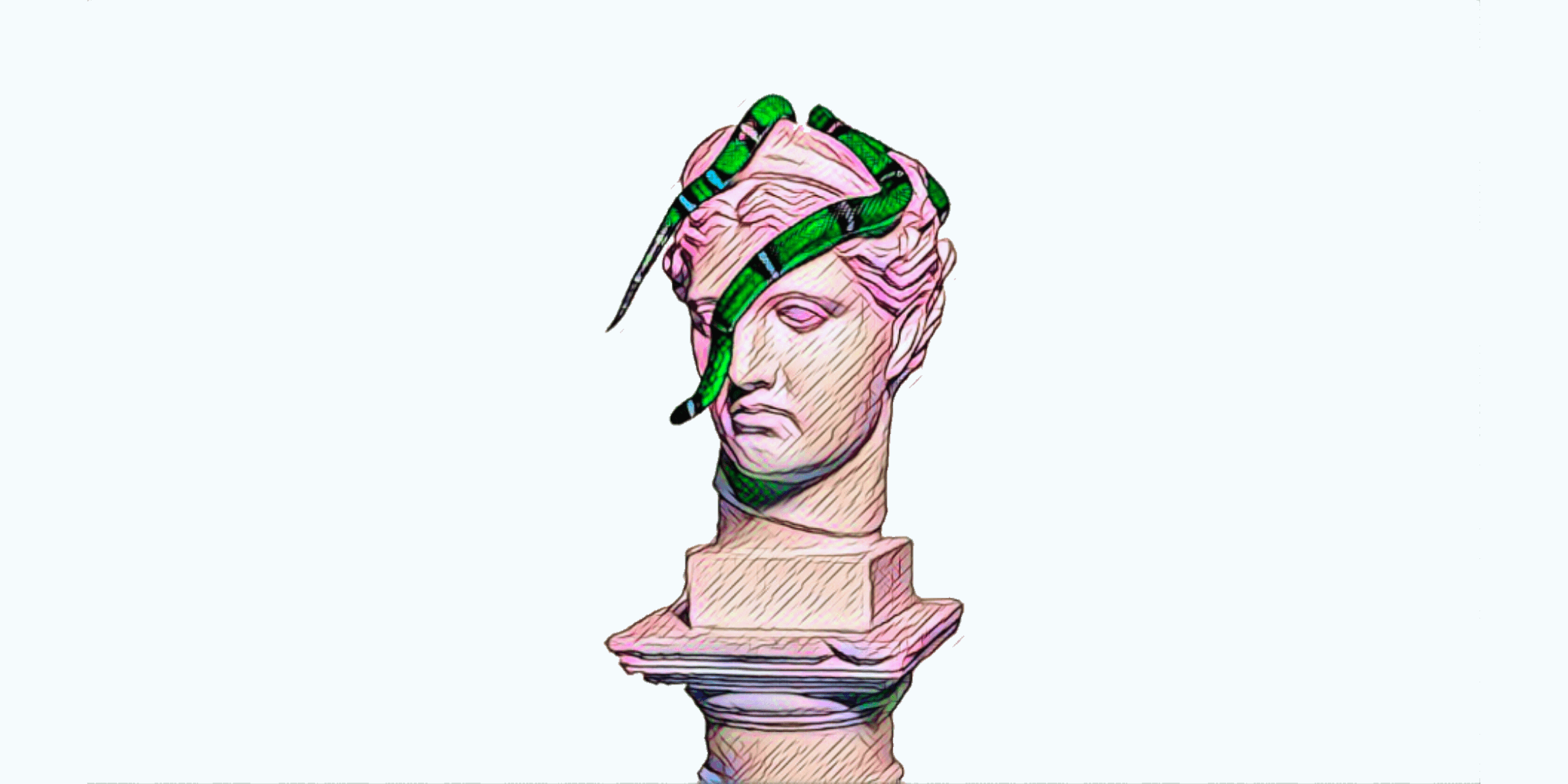Ich habe das Glück in der luxuriösen Situation zu sein, im Hyde Park in London sitzen zu dürfen, sonnengetränkt Tauben, Enten, Schwänen – und diversen Konstellationen von diesen drei Tieren, mit etwas der lokalen Kanalratte – beobachten zu dürfen, und gleichsam diese Kolumne schreiben zu dürfen. Um in dieses städtische Ideal voller Widersprüche – die sich in Form des Geburtsortes des neoliberalen Ideals, in Form von ökonomischen Schulen, die jegliche staatliche Einflüsse in den Markt untersagen, und in Form von Staatstragenden Charakteren wie Margot Thatcher oder die neue Premierministerin Liz Truss, und in Form des sozialistischen Aktivismus, symbolisiert durch Karl Marx, der in London seinen Lebensabend in ärmlichen Verhältnissen verbrachte und sich in politischen Aktivismus übte, oder in Form vom Geburtsland der Gewerkschaften – fahren zu dürfen, habe ich mich verschuldet. Ich weiß zwar, dass dieses Gefühl der Schuld bloß ein Kurzfristiges sein wird, aber dieses Gefühl der damit einhergehenden Scham scheint mir besonders zu sein. Dieses Ziehen tief in der Magengegend: ein Gefühl, welches dem des Verliebtseins auf einer sadistischen Weise ähnlich zu sein scheint. Der zu häufige und nervöse Blick auf den eigenen Kontostand. Das nicht völlig freie Bewegen durch die Londoner Bar- und Restaurantszene und durch die kleinen verwinkelten Gassen mit den unzähligen Möglichkeiten des Konsums, an dem man nicht partizipieren kann, auch wenn einem andauernd erklärt wird, dass der Sinn des Lebens in diesem liegen soll. Man streift durch die edlen Gebiete der Stadt und träumt nahezu neidbehaftet von einem bourgeoisen Leben. Die Enttäuschung des mitreisenden Gegenübers – welche man vermutlich mehr in diese hineindeutet, als dass diese tatsächlich existent ist – wenn man erklären muss, dass das eigene Geld für bestimmte Aktionen nicht ausreicht. Ich würde und habe schon häufig mein metaphorisch letztes Hemd gegeben, um dies nicht erleben zu müssen. Dieser andauernde Schleier der Scham legt sich über den Tag, trübt den eigenen Verstand, die eigene Kunst und den Blick auf die Schönheit der Dinge, die einen umgeben.
Aber ich bin in einer besonderen Situation. Meine Schulden sind temporär. Mein Kontostand wird in wenigen Tagen wieder ausgeglichen sein. Ich habe soziale Fallnetze von mich liebenden Menschen, die mir unterstützend zur Seite springen können. Ich bin nicht gebunden an finanzielle Verantwortungen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass ich als Anhänger des kreativen Milieus und als Student, und aufgrund des damit einhergehenden kreativen Kapitals die Möglichkeiten besitze, mich bis zu einer bestimmten Grenze zu verschulden. Dies wird mir ermöglicht, da ich mich einerseits in der Regel nicht fragen muss, wo mein nächster Gehaltscheck herkommt und es andererseits als Teil der studentischen Identität verstanden wird, in finanzieller Verlegenheit zu leben – kurz zum Begriff „finanzielle Verlegenheit“: sehr treffend, wie an dieser Stelle die Scham Teil des Sprechens über Geld zu sein scheint – vermutlich, um den BWL-Student*innen Demut zu lehren, bevor dieser im finanziellen Überfluss lebt, und um dem Geisteswissenschaftler die frugale Hingabe für sein Fach direkt im Studium beizubringen. Trotz allem löst dieses Sprechen über Geld ein unangenehmes Zerren in meiner Magengegend aus, welches ich als Gefühl der Scham ausmachen kann. Hier in dieser Kolumne und in aller Öffentlichkeit, die ich hier in der Kolumne genießen darf, möchte ich dieser für mich, und vermutlich für viele andere, mit Scham behafteten Thematik nachfühlen. Aber vor wem äußerst sich diese Scham? Vor der Instanz der Bank? Vor einem selbst? Vor den Mitreisenden?
Schulden bei Banken aufzunehmen, wie ich es für diese Reise tat, ist eine übliche Praxis, bloß trifft dies Gesellschaftsschichten unterschiedlich. So kann Elon Musk mit einem Vielfachen seines real verfügbaren Vermögens Twitter kaufen, indem dieser einen Darlehen bei einer Bank aufnimmt. Banken reißen sich um diese Vergabe. Dieses neue Darlehen ermöglicht ihm wiederum Steuererleichterungen in Milliardenhöhen, da er diesen über sein Unternehmen abschreiben lassen kann. Ein Darlehen aufzunehmen, kann ein Milliardengeschäft sein und ist eine übliche Handlung für Superreiche, die ihren vermeintlichen gesellschaftlichen oder sozialen Wert in mehr Geld verwandeln können. Diese Praxis scheint also – auch wenn wir womöglich die Empfindung haben, dass dies zu verurteilen ist – keine Schambehaftete zu sein. Sie könnte von Kapitalisten gar als eine gebotene Handlung verstanden werden, aufgrund der Tatsache, dass beide Parteien Teil des Vertrages sein wollen. Scham und ihre Kollektivierung sind abhängig von einer im Vor- oder Nachhinein bewussten Verletzung von Regeln und Normen. Diese Umstände des Bewusstseins des eigenen amoralischen Verhaltens schaffen das Bewusstsein versagt zu haben und löst die quälenden Empfindungen aus die wir als Scham verstehen.
Schulden können für Menschen aus prekären Verhältnissen etwas höchst Zermürbendes sein. Banken zerren sich nicht um ihre Kreditschulden. Der Alltag wird von Mahnungen begleitet. Der schambehaftete Gang als sogenannter „Aufstocker“ zum Arbeitsamt, um mit diesem zu sprechen, fällt einem so schwer, dass man ihn erst gar nicht antritt. Während die neuen rekordbrechenden Vermögen der Superreichen zelebriert werden, scheint das Sprechen über den eigenen Verdienst, die bestehenden Schulden und die Mahnungen zutiefst schambehaftet zu sein und man schweigt lieber. Nicht bloß der Mangel an Geld hat etwas zutiefst sozial Exkludierendes, sondern auch der damit einhergehende Schleier der Scham. Das nächste Mal, wenn man vor einem Obdachlosen steht – Menschen, die schnell als Aussätzige, dem System feindlich gesinnte, verstanden werden – und nach wenigen Cents gefragt wird, sollte man sich vor Augen führen wie sozial-ausgeschlossen und entfremdet man sein muss, um diese Grenzen der Scham nicht mehr zu empfinden? Aber ich habe auch ein Verständnis für diejenigen, die aus prekären Verhältnissen kommend, sich einer kapitalistischen Systemlogik ergeben und vor der Scham fliehen.
Die libertäre Ansicht wäre, dass gerade hier die eigentliche Motivation der Produktivkraft zu stecken scheint. Es liegt in der häufigen Wahrnehmung einer kapitalistischen Gesellschaft, dass Scham gerade in Hinsicht ökonomischer Zwänge ein konstruktives Konstrukt sei, um die Produktivität der Ökonomie zu fördern. Scham soll als Mittel der Befreiung aus der eigenen Unmündigkeit dienen. So könnte der Ausruf vieler Libertärer wie folgt klingen: „Vom schambehafteten Tellerwäscher (und Schuldner) zum schamlosen Millionär.“ Eine solche Internalisierung der Scham, und ihre andauernde Überwindung, soll mich also zu einem produktiven Teil der Gesellschaft machen? Dem preußischen und reaktionären Ideal der bürgerlichen Arbeiter*in folgend soll ich als Produktivkraft degradiert und meiner Menschlichkeit beraubt ein konstruktiver Teil einer kapitalistischen Gesellschaft werden. Bei Abweichungen von einer solchen Linie bringt mich die Scham, da ich gegen dieses Wertegerüst verstoßen habe, zurück auf das richtige Gleis. Aber wie garantieren wir, dass sie in Wirklichkeit keine ungemein destruktiven Vorgänge anstößt, sondern Scham, im Hinblick auf das Ökonomische, bloß ein Mittel, gar eine gesellschafterhaltende Tugend ist, um die vermeintlich Schwachen und nicht Würdigen aus dem Prekariat zu unterdrücken?
Die Internalisierung der Scham im Herzen einer bürgerlichen Schuld als ein kapitalistisches und systemrelevantes Phänomen zu verstehen, scheint mir richtig zu sein, aber was ist nun der eigentliche Ursprung der Scham? Denn: Ist Scham nicht etwas zutiefst Intersubjektives? „Scham hat ihren Ursprung gerade nicht darin, dass man etwas Verbotenes tut oder ist, sondern im Abreißen der Kommunikation, der Verbindung mit dem Anderen. Sie entsteht in dem Moment, in dem diese Verbindung plötzlich nicht selbstverständlich, und die eigene Abhängigkeit dadurch umso entsetzlicher deutlich ist“, schreibt Lea Schneider in ihrem Werk Scham 2021. Scham scheint – selbstreferentiell und phänomenologische betrachtet – etwas zu sein, dass erst im Kontext mit anderen des Systems Partizipierenden entsteht. Sie beginnt in der Etablierung eines Selbstbildnisses, welches zum Träger der eigenen Identität in Gesellschaft wird, und gerade die mögliche Verzerrung oder gar Zerstörung eben dieser sozialen Identität kann diese Scham zur Folge haben. Die Angst, ein Teil seiner eigenen Identität vor dem Anderen zu verlieren, scheint der Urgrund der Scham zu sein. Wäre dieses Andere nun auch noch ein Elternteil – und nicht wie hier intendiert die Gemeinschaft, von der Gesamtheit des eigenen sozialen Netzes bis hin zur allgemeinen Gesellschaft, gemeint – wäre der psychoanalytische Twist perfekt.
Als Randbemerkung sei bemerkt: Die Scham und ihre Internalisierung im Sinne von ökonomischen Zwängen mag auch an ein gesellschaftliches Ideal von Männlichkeit – oder eher Machtdifferenzen innerhalb der Sexualität – geknüpft zu sein, welches sich toxisch auf mich und andere Männer, Frauen und Diverse auswirkt und sich so aufgrund ihres intersubjektiven Gehalts sich selbst erhält. Das Patriachat durchzieht nicht bloß diese zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch die patriarchalen Bilder der Kultur, wie beispielsweise, dass der Erbsünde, auch Urschuld genannt, ist durchweg hierdurch geprägt, und auch wenn dieses Verständnis meine Bildauswahl prägt, verschieben wir diese Thematik ebenfalls.
Ich versuche nicht eine Kolumne zu schreiben, die die Scham als Gefühl vollends überwinden möchte. Ich plane nicht eine nietzscheanisch anmutende Rechtfertigungskategorie zu erschaffen, die außergewöhnlichen Menschen „im Sinne des allgemein menschlichen Fortschritts natürliche Vorrechte“ einräumt und erlaubt, zu morden, oder versuche nicht irgendeinem anderen Amoralismus zu frönen. Scham kann ein überaus mächtiger Garant für moralisch-gute Handlungen sein. So sei bezüglich der ökonomischen Zwänge und der damit einhergehenden Scham bloß gesagt: Entgegen der allgemeinen Annahme, dass das Sprechen über Geld keine Tugend sei, sollte wir beginnen, dies zu tun, nicht bloß, um den Arbeitsmarkt transparenter und fairer zu gestalten, sondern um auch Themenfelder, wie beispielsweise Schulden, zu entstigmatisieren, und um dem damit einhergehenden allgegenwärtigen, erdrückenden Schleier der Scham entgegenzuwirken. Ein Wandel in der Neuordnung von gesellschaftlichen Normen hat Rückwirkungen auf individuelles Empfinden und Verhalten. Ein Leben ohne einen Schleier der Scham, der eigenen Angst das erschaffene Selbstbildnis vor sich und anderen verlieren zu müssen, ermöglicht uns unseren wahren Leidenschaften zu widmen, und nicht ein Minimalgerüst aus Lebenssicherung und Status aufrecht erhalten zu müssen.
Diese Kolumne mag wirr und unklar wirken und ich entschuldige dies. Ich glaube nicht, dass ich die Fülle dieses Themas wirklich einfangen konnte, womöglich aufgrund der Komplexität, meiner eigenen Verworrenheit in ihr, oder da ich die Thematik noch nicht vollends gefasst habe. Selbstverständlich liegt es nicht an meinem Londonurlaub. Aber ich möchte an meine Absichtserklärung in der ersten Kolumne zurückerinnern: „Kolumne als Schreibübung“.
Text- und Bildrechte: Marcel Guthier.